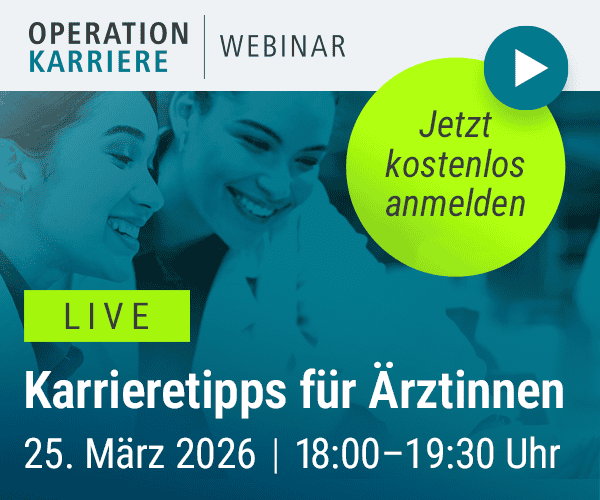Was ist beim Berufsstart wichtig? Zu diesem Thema gab Schimpfle den Kongressteilnehmerinnen und -teilnehmern in seinem Vortrag einige hilfreiche Checklisten an die Hand.
Für ihn selbst sei die Frage “Wo fängt man an?” am schwierigsten gewesen, gab der Vertreter der “Jungen Kammer” zu. Soll man die Weiterbildung lieber an der Uniklinik machen oder an einem kleinen Haus? Oder ist ein mittleres Haus der goldene Mittelweg? Für eine leichtere Entscheidung zählte er Vor- und Nachteile auf:
Weiterbildung an der Uniklinik: Vor- und Nachteile
+ Forschungsmöglichkeiten: Für alle, die sich für Forschung interessieren, ist die Uniklinik fast Pflicht
+ Arbeiten nach aktuellem Forschungsstand: An der Uniklinik werden die neuesten Forschungsergebnisse und Paper schneller in die medizinische Versorgung eingebunden als in kleineren Häusern
+ Breites Ausbildungsspektrum
+ Interdisziplinäre Zusammenarbeit: Es sind immer Ärztinnen und Ärzte aus verschiedenen Fachgebieten vor Ort – auch, wenn man Nachtdienst in der Notaufnahme hat
+ Eventuell größeres Team und weniger Dienste
– Eventuell anonymer: Durch große Abteilungen und viele Assistenzärztinnen und -ärzte in den einzelnen Bereichen ist es schwieriger, andere kennenzulernen und sich zu vernetzen
– Eventuell strengere Hierarchien
– Spartenlernen: Starke Fokussierung auf das eigene Fachgebiet, weniger Blick über den eigenen Tellerrand
– Eventuell (un)selbstständigeres Lernen: In der Uniklinik hat man beim Lernen eventuell weniger Freiheiten. Aber: Häufig sind die Vorgesetzten durch andere Forschungs- und Lehrverpflichtungen verhindert. Das zwingt wiederum zu mehr Selbstständigkeit.
Weiterbildung an einem kleineren Haus: Vor- und Nachteile
+ Familiärer: Man hat einen besseren Kontakt zu Kolleginnen und Kollegen
+ In der Regel flachere Hierarchien
+ Schnelleres Lernen von Basismedizin: Man hat ein breiteres medizinisches Spektrum am Anfang – die komplizierteren Fälle werden in der Regel an die Unikliniken verlegt.
– Oft begrenzte Weiterbildungsmöglichkeiten: Abhängig vom Angebot der Klinik muss man eventuell Teile der Weiterbildung in einem anderen Haus absolvieren
– Nicht immer Orientierung an aktueller Forschung
Hospitation: Wie erkenne ich eine gute Abteilung?
Um zu erfahren, wie das Arbeitsklima in der Abteilung wirklich ist, sei eine Hospitation wichtig, erklärte Schimpfle. Wenn möglich sollte man vor der Vertragsunterzeichnung auch einen ganzen Tag zum Probearbeiten vor Ort sein. „Im Gespräch sagen die Chefärztinnen und -ärzte natürlich, dass alles super läuft – egal, ob das stimmt oder nicht“, verriet der Kammervertreter. Wer mit den Assistenzärztinnen und Ärzten rede, erfahre eher die Wahrheit.
Wichtige Fragen während der Hospitation:
- Weiterbildungsplan: Gibt es einen strukturierten Plan? Wie läuft die laut Plan Weiterbildung ab? Und funktioniert das auch?
- Rotation: Gibt es feste Rotationen? Und wie leicht bekommt man seine Wunschrotationen? Oder gibt es lange Wartelisten? Wie lange dauern die Rotationen (nicht länger als sechs Monate!)?
- Strukturierte Einarbeitung: Wie läuft die Einarbeitung ab? Gibt es dafür ein Konzept? Muss man gleich am Anfang Dienste machen oder kann man erst die Abläufe in Ruhe kennenlernen?
- Fluktuation im Team: Wie viele haben im vergangenen Jahr gekündigt und wie lange sind die Kolleginnen und Kollegen schon dabei?
- Dienstbelastung: Wie viele Wochenenden muss man arbeiten? Gibt es Nachtdienste und wie viele?
- Überstunden: Wie wird mit Überstunden umgegangen? Gibt es Freizeitausgleich?
- Hintergrund: Ist der Oberarzt / die Oberärztin bzw. andere erfahrene Kolleginnen und Kollegen während der Dienste erreichbar?
- In operativen Fächern: Blick auf den OP-Plan: Sind die Assistenzärztinnen und -ärzte für OPs eingeteilt? Dürfen sie selbst operieren oder nur zusehen und Haken halten? Welche Art von Eingriffen darf gemacht werden? Entspricht der OP-Plan dem Weiterbildungsplan?
- Weiterbildungsbefugnis: Hat meine zukünftige Abteilung eine Weiterbildungsbefugnis? Und auf wie viele Monate ist die Weiterbildungsbefugnis begrenzt?
Was muss ich beim Arbeitsvertrag beachten?
- Arbeitgeber tarifgebunden? Dann gilt der Tarifvertrag
- Arbeitgeber nicht tarifgebunden? Dann müssen die Vertragsbedingungen einzeln verhandelt werden
- Einzelbestandteile können auch bei tarifgebundenen Verträgen frei verhandelt werden (z.B. Opt-Out, Teilzeitbeschäftigungen)
- Prüfung des Arbeitsvertrages durch einen Juristen vor Unterschrift (kostenlos bei Gewerkschaften/Berufsverbänden)
Welche Versicherungen brauche ich beim Berufsstart?
- Private Haftpflichtversicherung: Unabhängig vom Beruf – bei Schäden im privaten Bereich
- Berufshaftpflicht: Bei angestellter Tätigkeit: Abdeckung vieler Risiken durch die Haftpflichtversicherung des Arbeitgebers. Zusätzliche Absicherung sinnvoll bei z.B. grober Fahrlässigkeit oder bei ärztlicher Tätigkeit außerhalb des Arbeitsplatzes
- Private Absicherung für das Alter/Berufsunfähigkeit? Abhängig von den genauen Umständen des Einzelnen, daher ist eine gute Beratung wichtig.
Organisatorische Herausforderungen beim Berufsstart
Bevor man den ersten Job als Arzt oder Ärztin antreten kann, gibt es noch einige organisatorische Hürden zu überwinden:
- Beantragung der Approbation
- Mitgliedschaft in der Ärztekammer & Arztausweis beantragen
- Bewerbung und Hospitationen
- Anmeldung im ärztlichen Versorgungswerk und Abmeldung in der Deutschen Rentenversicherung
Zum Ende seines Vortrags riet Schimpfle den Teilnehmenden noch, sich nicht von Fehlern entmutigen zu lassen: Der Weg zum Erfolg sei nicht geradlinig, sondern verschlungen. Aber trotz etlicher Rückschläge lande man am Ende da, wo man landen solle. Der Arztberuf sei trotz aller Schwierigkeiten immer noch sehr schön und erfüllend.
Quelle: Operation Karriere-Kongress Heidelberg, 25.11.2023, „Impulsvortrag: Berufs-, Karriere- und Lebensplanung – Was junge Medizinerinnen und Mediziner zum Berufsstart beachten sollten”, Dr. med. Lukas Schimpfle, Arbeitskreis junge Kammer