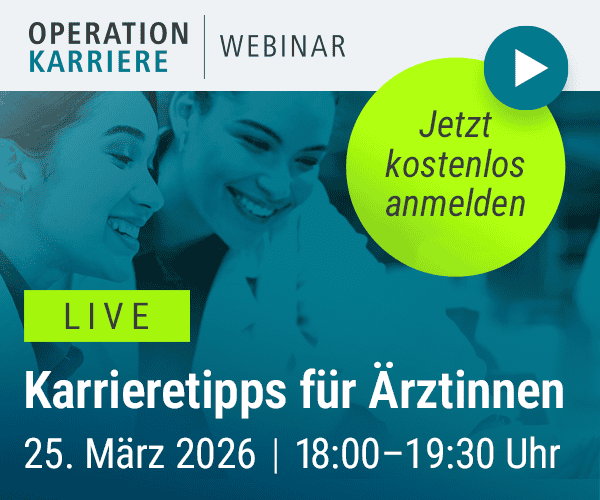Die Kommunikation mit Patientinnen und Patienten sowie deren Angehörigen kann Ärztinnen und Ärzte auf eine harte Probe stellen. Dr. Dirk Faas ist Chefarzt und Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin und weiß, dass er einer großen Bandbreite von Kindern bis Eltern gegenübersteht und sich in der Kommunikation ganz anders anpassen muss.
Was zeichnet Angehörige aus?
Er arbeitet in einem Fachkrankenhaus und neurologischer Rehabilitationsklinik für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Dabei hat er natürlich nicht nur mit dieser Gruppe, sondern auch mit deren Angehörigen zu tun. Seine Patientinnen und Patienten zeichnen sich durch vielseitige Merkmale aus:
- große Altersspanne
- (neu) chronische kranke/behinderte Patientinnen und Patienten
- Intensivtherapie bis Regelschule-Besuchende
- lange Liegezeiten
„Alles, was wir kommunikationstechnisch verbocken, fällt uns irgendwann auf die Füße“, sagte der Mediziner. Denn bei ihnen habe man durch die teilweise sehr langen Liegezeiten einen dauerhaften Kontakt. Wie auch bei Patientinnen und Patienten gibt es einige Aspekte, auf die man bei ihren Angehörigen achten müsse. Dazu gehören:
- unterschiedliche soziale Schichten
- verschiedene kulturelle Hintergründe
- emotionale Belastung
- „fit für zu Hause“
Es reiche nicht, sich nur auf die Vermittlung von Informationen zu beziehen. Angehörige müssen darauf vorbereitet werden, wie das Leben zu Hause mit schwerkranken Kindern wird, und angeleitet werden. „Wir haben einen Bildungsauftrag bei den Angehörigen“, erklärte Faas.
Wichtige Punkte bei der Angehörigenbetreuung
Im Zuge der Angehörigenbetreuung gebe es einige wichtige Punkte, von denen einige die Ärztinnen und Ärzte selbst, andere die Institution, in der sie arbeiten, und andere den Umgang aller miteinander betreffen:
- Organisation: Heutzutage ist es möglich, dass Angehörige mit im Zimmer des Patienten oder der Patientin bleiben können, auch bei Schwerkranken oder intensivpflichtigen Frühgeborenen. Bei Letzteren ergeben sich durch die Betreuung der Mutter, die natürlich emotional aufgewühlt ist, neue Aufgaben. Dieses Angehörigenmanagement hat in die Regelbetreuung Eingang gefunden, auch was die Organisation von beispielsweise zusätzlichen Räumen und Betten betrifft. „Organisation heißt auch, dass die Angehörigen einen Rückzugsraum für sich selbst haben“, erklärte Faas. Dort könnten sie sich untereinander austauschen, sich von der Belastung erholen und regenerieren. Räume müssen anders geplant werden. Ein gutes Beispiel seien auch Elternküche, wie sie häufig auf Kinderkrebsstationen vorkommen. „Ganz banal: Gutes Essen ist eine gute Sache“, schmunzelte der Mediziner. So können die organisatorischen Randfaktoren einen großen Beitrag für den Umgang mit den Angehörigen leisten.
- Formulare: Die mehrseitigen und kleingedruckten Formulare, die Angehörige vor dem Aufenthalt in der Klinik ausfüllen müssen, können eine große Herausforderung sein. Dabei benötigen sie Unterstützung. Hierfür könne man spezifisches Personal abstellen, das sich ausschließlich mit diesem Aspekt beschäftige. Außerdem sei es möglich, Angehörige mit einem Shuttleservice bei ihrer Anreise zu unterstützen, denn eine Unterbringung in der Klinik sei nicht immer möglich.
- Behandlung: Hier gehe es um den Umgang des Arztes oder der Ärztin mit den Patientinnen und Patienten selbst. Wichtig sei ein Rückzugsraum für Gespräche, auch bei Kleinigkeiten. „Wir führen keine Gespräche auf dem Gang. Es braucht das richtige Setting“, betonte Faas. Darüber hinaus müssen Eltern frühzeitig in die Behandlung, und was diese für die weitere Betreuung zu Hause bedeutet, mit einbezogen werden. Es sei essenziell, dass Eltern ihre Rolle wiederfinden. Das Personal könne mit einer guten Aufgabenverteilung unterstützen. Ebenso gehören Freiräume für die emotionale Begleitung der Angehörigen zur organisatorischen Verantwortung.
- Information und Emotion: Wenn Eltern und Angehörige wieder mit ihren Kindern nach Hause gehen, müssen sie verschiedene Dinge integrieren. „Sie müssen ihre Elternrolle, ihre aufgewühlten Emotionen, den Zugang zum Kind wieder finden“, beschrieb der Mediziner. Hier könne auch die Lenkung der Eltern sinnvoll sein, indem man sie anleitet, ihr eigenes Sozialleben nicht zu vernachlässigen, auch wenn das Leben manchmal schwerfalle.
- Kommunikationsmodelle: Ärztinnen und Ärzten sollten daran denken, dass sie verschiedene Dinge bei der Kommunikation bedienen müssen. „Neben der Inhaltsebene vor allem auch die emotionale Ebene“, erklärte Faas. Denn man habe mehr als ein Ohr und es gebe mehr als eine Botschaftsebene. Angehörigen helfe es außerdem, den Plan zu kennen und sich an diesem orientieren zu können. Auch eine psychologische Begleitung – sowohl für Angehörige als auch für das medizinische Personal – helfe bei der Kommunikation untereinander.
„Ein strukturiertes Vorgehen in der Gestaltung der Angehörigenbetreuung ist wirklich etwas, was den Umgang mit allen effizienter gestalten kann“, schloss der Mediziner.
Quelle: Vortrag „Patientenangehörige: Freund oder Feind? Der Umgang mit Angehörigen im Spannungsfeld zwischen Empathie und Lenkung“, Dr. Dirk Faas, Chefarzt und Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, Pädiatrische Intensivmedizin, Neonatologie, Klinik Bavaria Kreischa, Operation Karriere Berlin 09.12.2023