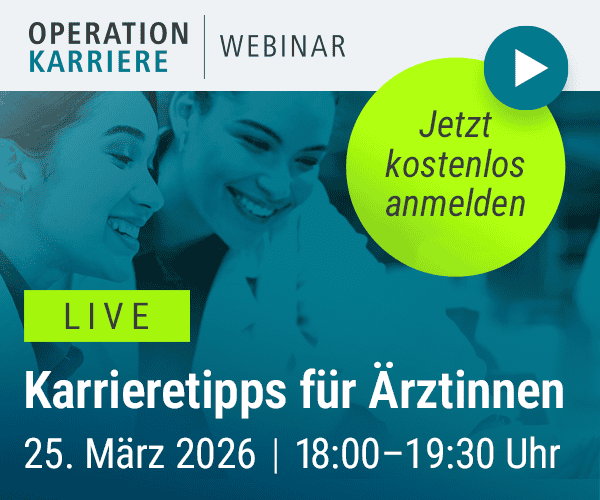Egal ob Ärztinnen und Ärzte, Pflegekräfte oder Therapeutinnen und Therapeuten: Gerade im Gesundheitswesen und der Patientenversorgung ist Mitgefühl eine essenzielle Fähigkeit. Patientinnen und Patienten wollen verstanden werden, wünschen sich Empathie und auch Geduld und Einfühlungsvermögen. Doch was passiert, wenn das nicht mehr möglich ist? Wenn Ärztinnen und Ärzte eher genervt, ungeduldig oder abgestumpft auf das Leid dieser Personen reagieren? Dann kann es sein, dass sie an der sogenannten Mitgefühlsmüdigkeit leiden.
Was ist Mitgefühlsmüdigkeit?
Der amerikanische Psychologe Charles R. Figley beschrieb 1995 Mitgefühlsmüdigkeit (Compassion Fatigue) als einen Zustand emotionaler, mentaler und physischer Erschöpfung, der durch die kontinuierliche Konfrontation mit dem Leid anderer entsteht. Besonders betroffen sind Berufe im Gesundheitswesen, beispielsweise Ärztinnen und Ärzte.
Obwohl sich Mitgefühlsmüdigkeit und Burnout in ihren Symptomen sehr ähneln, gibt es doch markante Unterschiede. Im Gegensatz zum Burnout, das maßgeblich durch chronischen Arbeitsstress und Überlastung entsteht, ist Mitgefühlsmüdigkeit das Ergebnis der empathischen Verbindung zu leidenden Menschen, aus der sich schließlich eine emotionale Erschöpfung ergibt.
Symptome der Mitgefühlsmüdigkeit
Genervt, ungeduldig oder abgestumpft – die Anzeichen einer Mitgefühlsmüdigkeit sind vielfältig und können individuell variieren. Häufige Symptome sind:
- Reduzierte oder fehlende Fähigkeit zur Empathie
- Gefühle von Ungeduld und Gereiztheit gegenüber Patientinnen und Patienten
- Fehlende Freude an der Arbeit
- Wut, Traurigkeit und Ängstlichkeit
- Stress, Ruhelosigkeit und Überforderung
- Schuld- und Schamgefühle aufgrund des mangelnden Mitgefühls
- Abwertung des Leids anderer („So schlimm ist das doch nicht.”)
- Zynismus
- Schlafprobleme
- Psychosomatische Symptome wie Kopfschmerzen oder Schwindel
- Rückzug und möglicherweise vermehrter Medikamentengebrauch
Diese Symptome können die Arbeitsweise erheblich beeinträchtigen und das Wohlbefinden der Betroffenen stark mindern. Oftmals entsteht die Mitgefühlsmüdigkeit über einen längeren Zeitraum, sodass sie erst bemerkt wird, wenn sie sich schon auf die Psyche und den Arbeitsalltag auswirkt.
Laut Studienlage leiden besonders junge Berufseinsteigerinnen und -einsteiger an Mitgefühlsmüdigkeit, weil sie noch nicht so viel Erfahrung, dafür aber hohe Erwartungen an sich selbst haben und nicht richtig mit diesen Gefühl umzugehen wissen.
Ursachen und Risikofaktoren
Ebenso wie die Symptome sind die Ursachen für Mitgefühlsmüdigkeit oft vielfältig und individuell unterschiedlich. Ein zentraler Faktor ist die ständige Konfrontation mit dem Leid und den Schmerzen der Patientinnen und Patienten, was zu einer emotionalen Überlastung führen kann. Dies kann sich durch Stressfaktoren, egal ob aus dem privaten oder beruflichen Bereich, noch verstärken. Hinzu kommen häufig organisatorische Herausforderungen wie Personalmangel, hohe Arbeitsbelastung und lange Arbeitszeiten, die den Stresspegel erhöhen. Auch fehlende Unterstützung im Team und mangelnde Möglichkeiten zur Supervision können das Risiko einer Mitgefühlsmüdigkeit steigern.
Maßnahmen und Lösungen für Betroffene
Um einer Mitgefühlsmüdigkeit entgegenzuwirken oder vorzubeugen, ist es wichtig, regelmäßig Auszeiten von belastenden Situationen zu nehmen und Abstand zu gewinnen. Folgende Strategien können hilfreich sein:
- Selbstfürsorge priorisieren: Regelmäßige Pausen, ausreichend Schlaf und die Pflege von Hobbys können helfen, das emotionale Gleichgewicht zu bewahren. Eine gute Work-Life-Balance ist essenziell für die eigene Gesundheit.
- Soziale Unterstützung suchen: Der Austausch mit Kolleginnen und Kollegen oder die Teilnahme an Supervisionen kann helfen, belastende Erfahrungen zu verarbeiten.
- Achtsamkeit, Entspannungstechniken, Sport: Methoden wie autogenes Training, Atemübungen oder Meditation können helfen, Stress abzubauen und die Resilienz zu stärken. Außerdem trägt Bewegung und Sport nachweislich zum Stressabbau und zum Abbau von Cortisol bei.
- Klare Grenzen setzen: Eine bewusste Trennung von Berufs- und Privatleben ist wichtig, um sich ausreichend zu erholen und neue Energie zu tanken.
- Fort- und Weiterbildungen besuchen: Schulungen zum Umgang mit Stress und zur Förderung der Resilienz können präventiv wirken und helfen, Strategien zur Bewältigung von Belastungen zu entwickeln.
- Professionelle Hilfe in Anspruch nehmen: Bei anhaltenden Symptomen ist es wichtig, psychologische Unterstützung zu suchen, um die eigenen Gefühle und Belastungen aufzuarbeiten.
Es ist wichtig, das Thema Mitgefühlsmüdigkeit offen anzusprechen und entsprechende Präventionsmaßnahmen zu ergreifen, um langfristig die eigene Gesundheit und die Qualität der Patientenversorgung sicherzustellen.