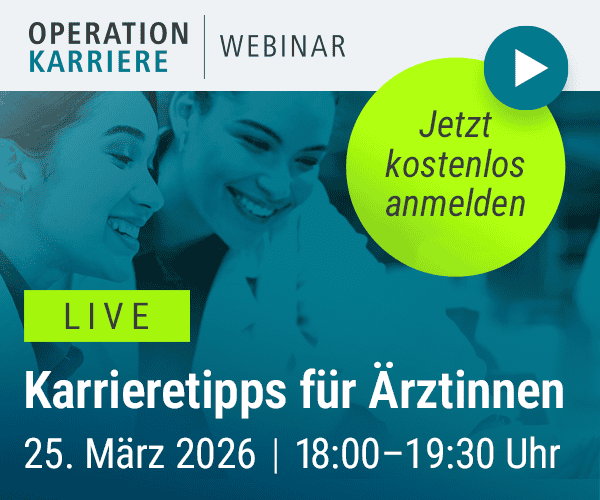Hierarchien in Kliniken: Ein System unter Druck
Die Arbeit in deutschen Kliniken ist traditionell stark hierarchisch organisiert. Oberärztinnen und -ärzte sowie Chefärztinnen und -ärzte stehen an der Spitze, während Assistenzärztinnen und -ärzte sowie PJ-Studierende oft am unteren Ende der Hierarchie agieren. Laut der aktuellen Mitgliederumfrage des Marburger Bundes empfinden viele Medizinerinnen und Mediziner diese Strukturen als belastend. 57 Prozent kritisieren, dass Entscheidungen nur bei wenigen Personen liegen, etwa 60 Prozent sind der Meinung, dass die starken Hierarchien Teamarbeit und Eigeninitiative erschweren und außerdem hinderlich für Innovation und Vielfalt sind. Dagegen halten 28 Prozent der Befragten die bestehenden Hierarchien für konstruktiv und 27 Prozent beschreiben sie als transparent.
„Die Machtstrukturen in Kliniken sind ungesund. Kaum eine andere Branche ist durch eine so starke Machtkonzentration bei gleichzeitiger Abhängigkeit von Vorgesetzten geprägt. Das schafft einen Nährboden für Machtmissbrauch“, beschreibt Dr. Pedram Emami, 1. Vorsitzender des Marburger Bundes Hamburg, die Situation. Um auch für junge Ärztinnen und Ärzte attraktiv zu bleiben, plädiert er für sowohl für transparente Stellenbesetzungen als auch für Vielfalt in Führungspositionen.
Machtmissbrauch gehört zum Alltag
Die Führungskultur in deutschen Kliniken steht ebenfalls im Fokus der Kritik. Das erschreckende Ergebnis der Umfrage: 87 Prozent der Befragten berichten davon, schon einmal Machtmissbrauch oder ungerechtfertigte Einflussnahme erlebt oder beobachtet zu haben. Ebenso beunruhigend: 81 Prozent haben rassistische, sexistische oder andere sachfremde Kommentare erlebt. Hier geben wir ein paar Beispiele aus den insgesamt 199 Freitext-Antworten:
- „Frage von Chef ‚Warum hatten wir noch nie Sex?‛ “
- „Frage nach der Farbe meiner Intimbehaarung“
- „Rassistische Kommentare über meine Herkunft“
- „Wie wollen Sie Fachärztin werden, Sie haben ja nicht mal einen Mann?“
Diese Probleme beim Thema Machtmissbrauch sind keine Einzelfälle. Das bestätigt auch Katharina von der Heyde, Geschäftsführerin des MB Hamburg. „Misogyne, sexistische, aber auch homophobe und rassistische Kommentare gehören leider auch 2025 noch zum Alltag vieler Ärztinnen und Ärzte. Das muss sich endlich ändern – und deshalb wollen wir das noch mehr öffentlich machen.“
Führungskultur massiv in der Kritik
Intransparent und ungerecht: So beschreiben viele der Befragten die Führung in ihren Kliniken. 54 Prozent geben an, dass ärztliche Führungspositionen bei ihnen kaum oder gar nicht divers sind. Nur Knapp fünf Prozent beschreiben sie als sehr divers. Außerdem trauen sich mehr als die Hälfte der Ärztinnen und Ärzte nicht, bei ihrer Führungskraft kritische Themen oder Missstände anzusprechen, weil sie negative Konsequenzen fürchten. Eine offene Fehler- und Feedbackkultur scheint nur für etwa neun Prozent möglich zu sein.
Ebenso kritisieren die Befragten in den Freitextantworten eine undurchsichtige Vetternwirtschaft bei Besetzungsverfahren für ärztliche Führungspositionen oder fragwürdige Führungsentscheidungen:
- „Förderung erfolgt nicht nach Leistung, sondern nach subjektiver Beliebtheit“
- „Frauen werden an Führungsentscheidungen nicht beteiligt. Es bestehen Männerzirkel, die Entscheidungen treffen.“
- „Entscheidung des Chefarztes gilt, obwohl sie den Leitlinien oder Studien nicht entspricht.“
Aber was sollte sich konkret ändern, damit sich die Führungskultur verbessert? In den Freitextantworten fordern die Befragten beispielsweise
- verpflichtende Fortbildungen zur wertschätzenden Personalführung für ärztliche Führungskräfte
- eine gezielte Frauenförderung
- eine Förderung von Teilzeit
- eine offene Kommunikation
- und objektive Kriterien bei Besetzungsverfahren
Die MB-Umfrage im Detail
Der Marburger Bund führte zwischen dem 7. und 25. Juli 2025 eine Mitgliederumfrage zu Machtstrukturen und Führungskultur in Hamburger Kliniken durch. An der Umfrage beteiligten sich 482 Ärztinnen und Ärzte. 62 Prozent von ihnen waren weiblich, 37 Prozent männlich und ein Prozent ohne Angabe. 35 Prozent befanden sich in Weiterbildung, 31 Prozent waren Fachärztinnen oder -ärzte, 22 Prozent Oberärztinnen oder -ärzte und zwei Prozent Chefärztinnen oder -ärzte.
Quelle: Marburger Bund Hamburg