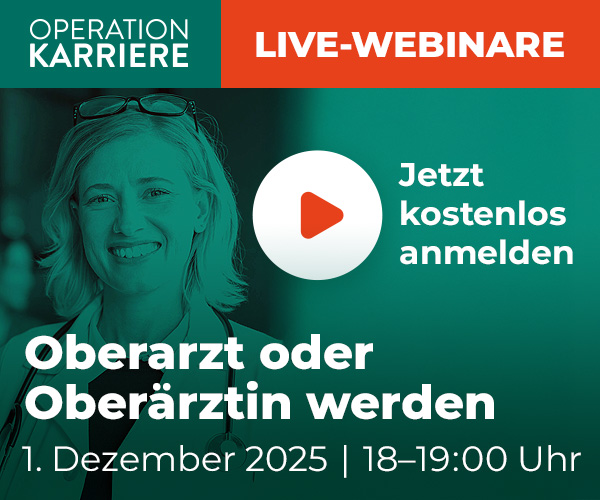In Krankenhäusern passieren täglich Fehler oder Beinahe-Fehler. Sie sind nicht automatisch ein Zeichen von Inkompetenz, sondern ein Hinweis darauf, dass in einem hochkomplexen System gearbeitet wird, in dem Menschen und Technik ständig an Schnittstellen interagieren. Die entscheidende Frage lautet nicht, ob Fehler passieren, sondern wie damit umgegangen wird. Eine gelebte Fehlerkultur denkt systemisch statt moralisch. Sie erkennt, dass die meisten unerwünschten Ereignisse nicht auf einen einzelnen „Fehltritt“ zurückgehen, sondern auf eine Verkettung kleiner Lücken in Prozessen, Kommunikation oder Technik. Sie setzt dort an, wo Prävention möglich ist: beim offenen, sanktionsfreien Austausch, der strukturierten Analyse und der konsequenten Umsetzung von Verbesserungen.
Warum Fehlerkultur Patientensicherheit schafft
Krankenhäuser sind Hochrisiko-Organisationen, deren Alltag durch hohe Arbeitsdichte, Zeitdruck, komplexe Patientensituationen und knappe Ressourcen geprägt ist. In diesem Setting können winzige Abweichungen, etwa eine unklare Übergabe, eine unvollständige Medikamentenbeschriftung oder ein nicht dokumentierter Allergiehinweis, gravierende Folgen haben.
Eine reife Fehlerkultur sorgt idealerweise dafür, dass diese Abweichungen sichtbar werden, bevor sie Patientinnen und Patienten schaden. Das funktioniert nur, wenn Meldesysteme wie CIRS (Critical Incident Reporting System) niedrigschwellig sind, Beinahe-Fehler ernst genommen werden und die Rückmeldung zuverlässig erfolgt. Ohne Feedback sinkt die Meldebereitschaft, und wertvolle Informationen gehen verloren.
Die Erfahrung zeigt, dass vor allem Formate wirksam sind, die sich in den Alltag integrieren lassen. Einige Beispiele:
- „Fehler der Woche“: ein 15-minütiges Lernformat im Team
- Safety Huddles: 5–10 Minuten tägliches Risiko- und Ressourcenbriefing
- Strukturierte Übergaben mit SBAR
- Readbacks bei Hochrisiko-Anordnungen
- Checklisten im OP oder auf Intensivstation
Was die Zahlen sagen
In deutschen Krankenhäusern gibt es durchaus ein Problembewusstsein in Sachen Fehlerkultur. So sind CIRS in mittlerweile 95 Prozent der Allgemeinkrankenhäuser etabliert, durchschnittlich etwa 54 kritische Ereignisse werden pro Jahr und Haus gemeldet; etwa jede zweite Abteilung nutzt das System. Gut 90 Prozent der Häuser beteiligen sich zudem am überregionalen CIRS-Netzwerk. Das meldete das Aktionsbündnis Patientensicherheit im Jahr 2023.
Dennoch besteht noch Luft nach oben: Die vom Aktionsbündnis Patientensicherheit koordinierte und vom Institut für Patientensicherheit am Universitätsklinikum Bonn unter Mitwirkung des Deutschen Krankenhausinstituts erstellte KhaSiMIR-21-Studie zeigt, dass strategische Ziele im Risikomanagement zu oft unklar bleiben und regelmäßige Fortbildungen fehlen. Mit andren Worten, die Fehlerkultur ist noch nicht da, wo sie sein sollte. Zudem zeigen Daten, dass bei 5–10 Prozent der Behandlungen unerwünschte Ereignisse auftreten, etwa ein Drittel davon vermeidbar. Das zeigt deutlich, dass Fehlerkultur keine Option, sondern Pflicht ist.
Praxisbeispiel: Lernen aus einem Beinahe-Fehler
Wie Fehlerkultur in den Alltag integriert werden kann, zeigen die SHG-Kliniken Völklingen. Die Kliniken haben bereits seit 2011 flächendeckend ein CIRS-System eingeführt. Im Rahmen des CIRS beschäftigt sich ein beauftragtes Auswertungsteam mit den gemeldeten Fällen und den damit verbundenen Fragestellungen und Problemen. Die eingehenden Meldungen werden durch ein interdisziplinär besetztes Auswertungsteam ausgewertet und monatlich gemeinsam besprochen und analysiert.
Ein praktisches Beispiel aus der Vergangenheit: Eine Pflegekraft meldete über das CIRS, dass bei einer Medikationsbestellung leicht die Infusionslösung und deren Konzentration verwechselt werden könnten. Statt die Meldung nur zu archivieren, reagierte das Team sofort: Das Bestellformular wurde angepasst, Risikoprodukte im Lager farblich markiert und für Hochrisikomedikationen ein zusätzlicher Doppelcheck eingeführt.
Das Ergebnis war mehr als eine technische Änderung. Die Mitarbeitenden erlebten, dass ihre Meldungen Wirkung haben. Die Meldequote stieg, weil klar war: Hier passiert etwas, wenn Probleme benannt werden. Und genau das ist der Kern einer funktionierenden Fehlerkultur, nämlich das Bewirken von schnellen, sichtbaren Verbesserungen, die das Vertrauen stärken.
CIRS, M&M, Safety Huddles – was wirkt
CIRS ist das zentrale Werkzeug für das anonyme oder vertrauliche Melden kritischer Ereignisse und Beinahe-Fehler. Es entfaltet seinen Nutzen, wenn
- die Eingabe maximal drei Minuten dauert
- wenige Pflichtfelder vorhanden sind
- die Analyse professionell erfolgt, etwa mit Human-Factors-Methoden
- die Maßnahmen innerhalb von zwei Wochen rückgemeldet werden
Morbiditäts- und Mortalitätskonferenzen (M&M) gehen einen Schritt weiter. Hier werden komplexe Fälle multiprofessionell aufgearbeitet, und zwar mit Blick auf Indikation, Teaminteraktionen, Ressourcensituation und mögliche kognitive Verzerrungen. Entscheidend dabei ist ein respektvolles, lösungsorientiertes Setting: Niemand wird an den Pranger gestellt, sondern es geht darum, einen Lernraum zu schaffen.
Safety Huddles hingegen wirken präventiv. Im Schichtwechsel werden besondere Risiken, Patientinnen und Patienten mit kritischem Verlauf, Engpässe oder Technikprobleme besprochen. Dieses „Mikromanagement der Sicherheit“ verhindert, dass sich kleine Abweichungen unbemerkt summieren.
Gründe, warum Fehler im Krankenhaus nicht gemeldet werden
- Angst vor Konsequenzen: Sorge um disziplinarische Maßnahmen oder Imageschaden
- Hierarchien: Mitarbeitende fühlen sich nicht sicher, Kritik nach oben zu äußern
- Zeitmangel: Meldesysteme sind zu kompliziert oder zeitaufwendig
- Fehlendes Vertrauen: Zweifel, ob Meldungen zu Verbesserungen führen
- Keine Rückmeldung: Meldungen verschwinden im „Nirwana“ ohne sichtbare Konsequenz
Lösung: Niedrigschwellige, schnelle Meldeprozesse mit garantierter Rückmeldung und sichtbaren Verbesserungen erhöhen die Bereitschaft, Vorfälle zu dokumentieren.
Zahlen, die nicht ignoriert werden können
Welchen Einfluss Fehler auf die Behandlungsqualität haben, ist messbar. Jährlich erleiden nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) Millionen von Menschen weltweit Schäden im Zusammenhang mit medizinischen Behandlungen.
Nach Angaben von Statista wurden im Jahr 2023 in Deutschland insgesamt 3.595 Gesundheitsschäden infolge ärztlicher Behandlungsfehler festgestellt. Von diesen Fällen führten 63 Behandlungsfehler zum Tod der Patientinnen und Patienten. Die Fehler traten sowohl im ambulanten als auch im stationären Bereich auf, wobei etwa ein Viertel der Verdachtsfälle bestätigt wurde. Besonders häufig kam es zu Fehlern in medizinisch komplexen Eingriffen und Diagnosen. Im Durchschnitt ereigneten sich täglich mindestens sieben Behandlungsfehler mit gesundheitlichen Folgen. Da nicht alle Fehler erkannt oder gemeldet werden, geht man davon aus, dass die tatsächliche Zahl der Behandlungsfehler deutlich höher liegt.
Die Definition von Behandlungsfehlern umfasst ein breites Spektrum und reicht von fehlerhaften Laborwerten über Verwechslungen bis hin zu schwerwiegenden Zwischenfällen wie der Amputation falscher Gliedmaßen. Allerdings liegt die tatsächliche Zahl der Behandlungsfehler und der damit verbundenen Schäden deutlich höher, als es die vorliegenden Daten vermuten lassen. Ein Problem bleibt die hohe Dunkelziffer, denn in Deutschland gibt es keine verpflichtende Meldung schwerwiegender „Never Events“. Fachgesellschaften und der Medizinische Dienst fordern seit Langem eine bundesweite Meldepflicht, nicht um Schuldige zu finden, sondern um systematisch aus Fehlern zu lernen.
Was Ärztinnen und Ärzte konkret tun können
Eine gelebte Fehlerkultur stärkt das Team. Sie zeigt, dass Meldungen respektiert werden und verbessert Abläufe. Kommunikation wird transparenter, Hierarchien brechen leicht, und der Blick für Prozessverbesserung erweitert sich, und zwar auch über unterschiedliche Berufsgruppen hinweg, etwa zwischen Ärztinnen, Ärzten, Pflegekräften und technischer Assistenz. Das erhöht die Resilienz ganzer Teams.
Dabei beginnt eine reife Fehlerkultur nicht in der Geschäftsführungsetage, sondern auf Station, im OP, in der Ambulanz. Ärztinnen und Ärzte können dabei entscheidende Signale setzen:
- Melden erleichtern: CIRS mobil zugänglich machen, maximal drei Pflichtfelder
- Rückmeldung sichern: Jede Meldung erhält eine Antwort, und Verbesserungen werden sichtbar gemacht
- Standards schützen: SBAR, Readbacks, 6-R-Regel, Doppelchecks, Checklisten konsequent umsetzen
- Debriefings etablieren: 5–10 Minuten strukturierte Nachbesprechung nach kritischen Situationen
- Führung als Schutzschild: Sanktionsfreiheit aktiv zusichern, Schuldzuweisungen unterbinden, Prozessänderungen priorisieren
- Daten nutzen: Kernindikatoren wie Medikationsfehler oder Kommunikationsabbrüche im Teammonitor besprechen
Fehlerkultur ist Führungs- und Alltagsthema
Fehlerkultur ist kein optionales Feature und keine PR-Maßnahme. Sie ist klinische Exzellenzarbeit. Sie braucht Führung, die Vorbilder schafft, und Teams, die offen kommunizieren. Sie braucht Zahlen, um Schwerpunkte zu setzen, und Beispiele, um Menschen zu erreichen. Eine Kultur des Meldens, Lernens und Umsetzens reduziert Wiederholungsfehler und stärkt letztlich das Vertrauen im Team. Und Vertrauen ist am Ende genauso lebenswichtig wie jedes Medikament.
Positive Effekte einer gelebten Fehlerkultur
- Mehr Patientensicherheit: Kritische Ereignisse werden erkannt, bevor sie Schaden anrichten
- Bessere Teamarbeit: Offenheit reduziert Misstrauen und stärkt den Zusammenhalt
- Interprofessionelle Zusammenarbeit: Ärztinnen, Ärzte, Pflege und Technik ziehen an einem Strang
- Lernende Organisation: Prozesse werden kontinuierlich angepasst und optimiert
- Mitarbeiterbindung: Wer erlebt, dass seine Stimme zählt, bleibt motivierter im Team
Fazit: Fehlerkultur ist nicht nur ein Sicherheitsfaktor – sie ist ein Treiber für Qualität, Motivation und Innovation im Klinikalltag.