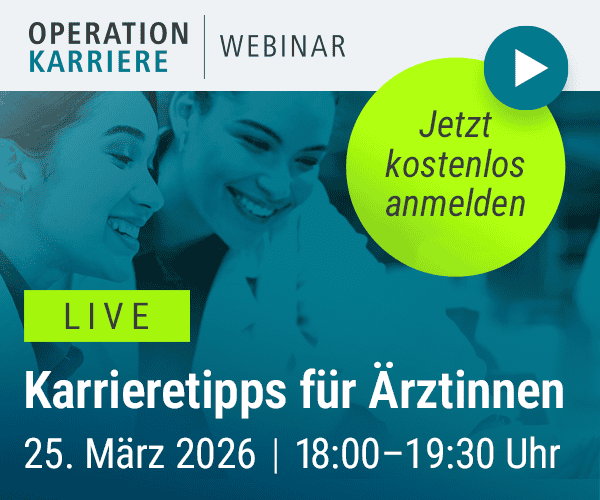„Effiziente Kommunikation bedeutet, dass das, was man kommunizieren will, auch beim Gegenüber ankommt – und zwar in beide Richtungen”, präzisierte der Chefarzt und Klinikdirektor für die Klinik Hämatologie, Onkologie und Palliativmedizin am Universitätsklinikum Brandenburg an der Havel seine Aussage. Das lateinische Wort „communicare” bedeute zunächst „teilen” oder „gemeinsam machen”. Dabei gehe es zunächst nicht um das Teilen von Informationen, erklärte Deckert.
Nach heutigem Verständnis geht es bei Kommunikation um das Zusammenspiel von Sender, Botschaft und Empfänger: Man hat eine Vorstellung von dem, was man sagen möchte, übersetzt es dann in Sprache, die die Botschaft transportieren soll. Der Empfänger oder die Empfängerin muss die Botschaft dann entschlüsseln. Mit etwas Glück kommt die Botschaft an und der Sender bekommt eine entsprechende Reaktion. Im Idealfall wechseln die Rollen von Sender und Empfänger im Laufe eines Gesprächs regelmäßig.
„Man kann nicht nicht kommunizieren!“
In den 1960 Jahren wurden unter anderem durch den Philosophen, Psychotherapeuten und Kommunikationswissenschaftler Paul Watzlawick die metakommunikativen Axiome entwickelt, die Deckert kurz vorstellte:
- „Man kann nicht nicht kommunizieren!“: Wenn jemand nicht auf eine Botschaft antwortet, findet trotzdem Kommunikation statt.
- „Jede Kommunikation hat einen Inhalts- und einen Beziehungsaspekt, wobei Letzterer den Ersteren bestimmt und daher eine Metakommunikation ist.“: Der größte Teil der Kommunikation findet auf der Beziehungsebene statt und die Beziehung bestimmt, welche Informationen rübergebracht werden.
Diese Axiome werden durch das „Vier-Ohren-Modell” ergänzt, dass der Kommunikationspsychologe Friedemann Schulz von Thun in den 1980er Jahren entwickelte: Danach beinhaltet Kommunikation immer einen Sachaspekt (Worüber spreche ich?), eine Selbstkundgabe (Was offenbare ich über mich selbst?), einen Beziehungsaspekt (Wie stehe ich zu meinem Gegenüber?) und einen Appell (Was will mein Gegenüber von mir?). Diese vier Aspekte hängen untrennbar zusammen. Das kann zu Missverständnissen führen – nicht nur im privaten Gespräch, sondern auch innerhalb des Teams oder bei der Arzt-Patienten-Beziehung.
„Eine aktuelle Studie zeigt: ChatGPT kann Patientenfragen in einem Online-Forum besser und empathischer beantworten als die Ärztinnen und Ärzte selbst”, erklärte Deckert. Daraus ergibt sich: Wenn sogar eine künstliche Intelligenz empathische Kommunikation lernen kann, können Menschen das erst recht.
Mit Worten heilen
Das Ziel der ärztlichen Handlungen sei in erster Linie die erfolgreiche Behandlung der Patientinnen und Patienten, erklärte Deckert. Zu der Frage, wie sich dieses Ziel erreichen lasse, zitierte er Paracelsus: „Zuerst heile mit dem Wort, dann mit der Arznei und zum Schluss mit dem Messer.“
Positive Effekte effizienter Kommunikation:
- Höhere Patientenzufriedenheit
- Effektiverer Informationsgewinn
- Ethische und gesetzliche Pflicht: Autonomie, Einwilligungserfordernis
- Besseres Verständnis, bessere Compliance, erfolgreichere Behandlung
- Weniger Beschwerden, Klagen und Schadenersatzprozesse
- Höhere eigene Zufriedenheit
Der unmittelbare Kontakt zu den Erkrankten sei nicht das Add-On, sondern das Fundament des ärztlichen Handelns. Das gelte auch für die Kommunikation innerhalb des Teams, betonte der Chefarzt, sowohl interhierarchisch als auch interprofessionell. Dabei sollte man immer wertschätzend bleiben und die eigenen Grenzen anerkennen.
Wichtige Aspekte der Team-Kommunikation:
- Aufnahme-/Fallbericht an Vorgesetzte
- Anweisungen an Nachgeordnete
- Gegenseitige Wertschätzung
- Anerkennen eigener Kompetenzgrenzen
Und speziell in der Notfallkommunikation (Crew Ressource Management:)
- Klare und eindeutige Kommunikation
- Aktive Fehlerkultur
- Abstrahieren von der Beziehungsebene
- Anerkennen von emotionalem Stress und gegenseitige Vergewisserung
Umgang mit Emotionen
Emotionen kommen in der ärztlichen Arbeit natürlich immer wieder vor und lassen sich nicht vertreiben. Aber: Der Umgang damit erfordere viel weniger Zeit, als die meisten denken, erklärte Deckert. Um systematisch mit Gefühlen umzugehen, helfe das NURSE-Schema, benannt nach den Anfangsbuchstaben der Begriffe „Naming, Understanding, Respecting, Supporting und Exploring”:
- Naming: Emotionen benennen und Spiegeln (Nur sinnvoll, wenn die Person nicht selbst schon gesagt hat, wie ihr zumute ist)
- Understanding: Wenn möglich Verständnis für die Emotionen ausdrücken (Wenn die Fachperson die Gefühle tatsächlich verstehen kann, tut Verständnis sehr gut. Hier kann man auch Wertschätzung ausdrücken, muss aber authentisch sein)
- Respecting: Respekt oder Anerkennung für den Patienten artikulieren (Berichte schwieriger Lebenssituationen bieten oft Möglichkeiten, das Bemühen, mit einer Belastung fertig zu werden, positiv zu konnotieren)
- Supporting: Dem Patienten Unterstützung anbieten (Hilfe wird professionell erst in Form eines Angebots erwähnt und nicht ungefragt sofort umgesetzt)
- Exploring: Weitere Aspekte zur Emotion herausfinden (Wichtig, wenn noch Aspekte unangesprochen im Raum stehen, die beim Naming und Understanding helfen können)
Auch beim Überbringen schlechter Nachrichten hilft eine systematische Herangehensweise, die mit dem Akronym SPIKES umschrieben wird. Hier stehen die Buchstaben für „Setting, Perception, Invitation, Knowledge, Empathy und Strategy / Summary):
- Setting: Gesprächsrahmen herstellen, Störungen vermeiden, Bezugsperson mit einbestellen etc.
- Perception: Wahrnehmung: Informationsstand des Patienten einschätzen – was weiß der Patient über seine Erkrankung?
- Invitation: Einschätzen der Bereitschaft, die „schlechte Nachricht“ aufzunehmen
- Knowledge: Ankündigung und Mitteilung der relevanten Informationen
- Empathy: Emotionen des Patienten beachten und auf diese eingehen (z.B. mit Hilfe des NURSE-Schemas)
- Strategy and summary: Zusammenfassen und weiteres Vorgehen besprechen
Tipps für gute Kommunikation
- Sei wertschätzend, höre und spreche wertschätzend!
- Höre!
- Achte auf das, was du mit deinen Worten nicht sagst – und vielleicht auch nicht meinst!
- Du musst nicht immer sofort die ganze Wahrheit sagen, aber sage immer nur die Wahrheit!
Für alle, die sich tiefer mit dem Thema beschäftigen wollen, empfahl Deckert einen Leitfaden der Ärztekammer Nordrhein, der online zum Download erhältlich ist: https://www.aekno.de/fileadmin/user_upload/aekno/downloads/2023/leitfaden-kommunikation-2023.pdf
Quelle: Effiziente Kommunikation ist gute ärztliche Arbeit, Prof. Dr. med. Peter Markus Deckert, Universitätsklinikum Brandenburg an der Havel GmbH, Operation Karriere Berlin am 9.12.2023