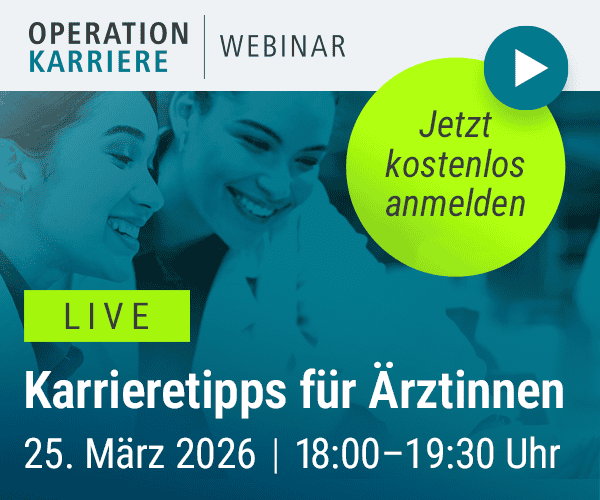Herr Paschen, was treibt Sie an?
Sebastian Paschen: Nach wie vor werden in unserem Gesundheitssystem die meisten Menschen nach dem gleichen Schema behandelt. Dieses orientiert sich – überspitzt gesagt – an „1,80 Meter großen, 80 Kilo schweren, weißen cis-Männern ohne Beeinträchtigung“. Wir möchten mit unserem Projekt acadim dazu beitragen, dass Medizin gerechter wird.
Was planen Sie konkret?
Sebastian Paschen: acadim soll eine Fortbildungsakademie für Diversitätsmedizin werden, die allen Fachpersonen im Gesundheitswesen offensteht. Zunächst nehmen wir uns die ärztliche Fortbildung vor, langfristig aber alle Bereiche, von Pflege über Physio- und Logotherapie bis zur MFA. Zweitens möchten wir die breite Bevölkerung mit Kampagnen aufklären. Drittens wollen wir Netzwerke schaffen. Es gibt in Deutschland schon etliche Personen, die sich mit dem Thema beschäftigen, aber meist nur in ihrer Bubble. Wir planen Forschende und klinisch tätige Personen zu verknüpfen. Unser Ziel ist, dass Ergebnisse nicht in der Schublade verschwinden, sondern wir möchten daraus neue Inhalte und Programme „stricken“ – um damit, viertens, auch die Forschung zu fördern.
Ein großer Plan. Hat er stabile Füße?
Sebastian Paschen: 2021 initiierten wir das lokale Studierenden-Projekt „Geschlecht in der Medizin“. Dank Kooperation mit der bvmd ist es inzwischen an zehn Unis vertreten. Es wurde von unserer Nachfolge in „Diversität in der Medizin“ umbenannt. Bald war klar, wir wollen mehr Menschen erreichen, vor allem auch außerhalb des Studiums. Daher bauen wir seit 2022 acadim auf. Per Zufall wurde gleichzeitig in Bochum Deutschlands erstes Institut für Diversitätsmedizin unter der Leitung von Prof. Marie von Lilienfeld-Toal gegründet. Wir wandten uns an sie und arbeiten seitdem zusammen.
Was macht acadim schon konkret?
Sebastian Paschen: Eine Fortbildungsreihe zu Diversität läuft mit der Deutschen Gesellschaft für Hämatologie und Onkologie bereits in der dritten Runde. Aktuell sind wir dabei, neue Kooperationen mit der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie und Klinische Immunologie sowie der Deutschen Gesellschaft für interdisziplinäre Notfall- und Akutmedizin zu schmieden. In punkto Aufklärung der Bevölkerung arbeiten wir mit dem Aktionsbündnis Patientensicherheit zusammen. 2024 hat die Medienagentur Scholz & Friends Health gemeinsam mit uns drei Poster zu geschlechtersensibler Medizin designt. Wir sind häufig unterwegs, halten viele Vorträge, sind immer wieder auf Kongressen.
Gab es eine Initialzündung?
Sebastian Paschen: Ja, ein schockierender Moment, der etwas zurückliegt. Moritz ist ausgebildeter Gesundheits- und Krankenpfleger, ich absolvierte bei ihm mein Pflegepraktikum. Wir arbeiteten damals auf der Intensivstation. Dort lag eine Patientin, deren Vorgeschichte klassisch ist. Sie hatte Bauchschmerzen, ging zum Hausarzt. Der diagnostizierte eine Magenverstimmung, sagte: „Nehmen Sie Buscopan, legen sich zwei Tage hin und alles ist gut“. Zu Hause erlitt sie einen fulminanten Herzinfarkt und wurde reanimationspflichtig. Damals taten wir das ab als „passiert halt“. Aber nachdem wir im Studium in einem Workshop von anderen Studierenden das erste Mal von Symptomunterschieden in der geschlechtersensiblen Medizin hörten, erinnerten wir uns wieder an diesen Fall. Wir dachten: „Krass, das passiert wirklich. Es sterben Menschen, weil diese Themen nicht adressiert werden.“ Und wir beschlossen etwas zu ändern.
Was umfasst die Diversitätsmedizin? Alles?
Sebastian Paschen: Das spielt in nahezu alle Bereiche der Gesundheitsversorgung hinein. Je tiefer man in das Thema hineintaucht, desto mehr Beispiele zeigen sich. Und diese wirken umso erschreckender, weil sie so alltäglich sind. So lernen wir in der Dermatologie oft nur anhand von weißer Hautfarbe. Wie Ausschläge auf nicht-weißer Haut aussehen, wissen wir meist gar nicht. In der Covid-Pandemie wurde zudem deutlich, dass die Medizintechnik ebenfalls oft auf weiße Hautfarbe geeicht ist. Folge war, dass Sauerstoffclips bei Schwarzen Menschen oft falsch-hohe Werte anzeigten, was zu schweren Komplikationen bis zum Tod führte.
Oder nehmen wir das riesige Feld der Pharmakologie. Hier wird bislang oft nicht darüber gesprochen, inwieweit man bei Dosierungen auf Geschlecht, Gewicht und Körpergröße achten müsste. Ein weiteres Thema sind psychiatrische Erkrankungen: In unseren Lehrbüchern findet sich oft eher die weibliche Symptomatik. Bei der Depression ist dies die soziale Isolation, der Rückzug. Männliche Betroffene tendieren dagegen oft auch zu übersteigerter sozialer Interaktion, agieren vermehrt aggressiv und neigen zu Suchtverhalten. Auch bei Osteoporose haben Männer schlechtere Chancen auf die richtige Diagnose.
Lässt sich Diversitätsmedizin überhaupt klar definieren?
Sebastian Paschen: Es gibt bislang kein Lehrbuch, in dem man nachschlagen kann, was sie umfasst. Diversitätsmedizin ist einfach sehr jung. Im Bochumer Institut werden dafür aktuell erstmal Grundlagen geschaffen. Man kann sagen: Es ist ein interdisziplinärer Ansatz, auf die Medizin zu schauen. Man sollte kontextbewusst und situationsbezogen die jeweils relevanten Diversitätsaspekte eines Menschen betrachten, beschreibt es Prof. von Lilienfeld-Toal. Die Kernaspekte sind unter anderem Geschlecht, Alter, sozioökonomischer Status, Betreuungs- und Pflegeverantwortung, sexuelle Orientierung, ethnische Herkunft und Nationalität, religiöse Überzeugungen und Weltanschauungen sowie körperliche und geistige Fähigkeiten. Es geht aktuell vor allem auch darum, diese zu systematisieren und Evidenzen zu schaffen.
Wie kann die Umsetzung aussehen? Muss ich das alles als Arzt oder Ärztin ständig mitbedenken?
Sebastian Paschen: Natürlich ist nicht jeder Aspekt immer wichtig. Ich sollte wissen, dass diese individuellen Faktoren eben auch eine Rolle spielen können. Die Thematik muss dringend vor allem in die Ausbildung integriert werden, um den Nachwuchs zu sensibilisieren. Wer von diesem Thema gehört hat, wird es auch später in der ärztlichen Praxis im Hinterkopf haben. Zudem möchten wir die vielen Facetten Stück für Stück gemeinsam mit den Fachgesellschaften in den Fokus rücken, um auch den bereits Praktizierenden zu zeigen: „Achtet bitte darauf“.
Sollen auch Patienten vermehrt proaktiv mitdenken? Dr. Google ist bei der Ärzteschaft doch eher verpönt…
Sebastian Paschen: Ich weiß, dass sich einige Kolleginnen und Kollegen mit Laiendiagnosen oft schwertun. Ich glaube jedoch, wer da direkt abblockt und sagt: „Das ist Quatsch. Jetzt seien Sie mal ruhig, ich weiß besser, was Sie haben“, stößt eher auf eine Reaktanz bei den Patientinnen und Patienten. Das ist auch nicht gut für das Behandlungskonzept. Ich finde es hingegen produktiv, aufgeklärte, informierte Menschen vor mir zu haben, mit denen ich arbeiten kann. Wir sollten von diesem paternalistischen Behandlungsprinzip weg und mehr in die Kommunikation gehen. Gemeinsam schauen, wo der Weg hinführt.
Spielt die KI bei acadim schon eine Rolle?
Sebastian Paschen: Wir denken sie mit, haben bereits Ideen für Kooperationen. Das Thema ist gerade in der Diversitätsmedizin enorm wichtig. Denn wenn man eine KI mit Daten füttert, bei denen Diversitätsaspekte nicht berücksichtigt werden, wird sie genauso falsche Entscheidungen treffen. Insgesamt gibt es zwar schon einiges an Wissen, aber strukturiert aufgearbeitete Daten fehlen auf vielen Gebieten noch. Das ist echt ein Problem.
Wo führt Ihr persönlicher Weg hin?
Sebastian Paschen: Wir wollen beide acadim auch langfristig, gemeinsam mit dem Bochumer Institut für Diversitätsmedizin, fortführen. Uns liegt das Thema am Herzen und die Arbeit daran macht uns auch viel Spaß. Trotzdem möchten sowohl Moritz als auch ich nach dem Studium eine fachärztliche Ausbildung anstreben. Moritz möchte Pädiater werden, ich Internist und Infektiologe – wir werden dann versuchen, das beides in Teilzeit unter einen Hut zu bringen.
Mehr Infos: https://acadim.de/