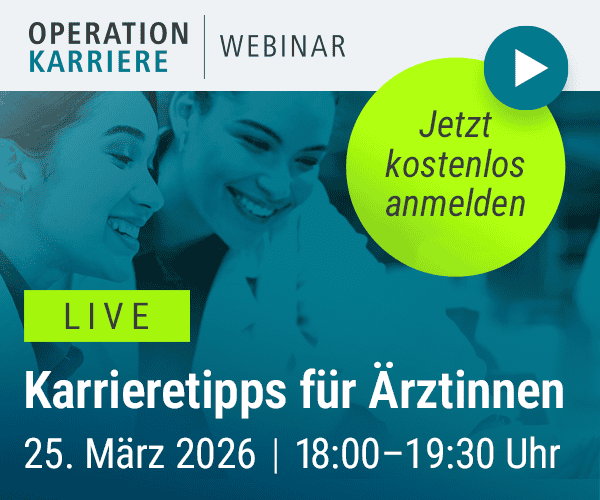Psychische Belastung und Suizidgedanken
Laut der WHO-Studie mit dem Titel “Mental Health of Nurses and Doctors ” (MeND) zeigt jede und jeder Dritte Symptome von Depressionen oder Angstzuständen. Besonders besorgniserregend: Etwa 10 Prozent der Befragten hatten in den letzten zwei Wochen passive Suizidgedanken, wie „besser tot sein“ oder „sich selbst verletzen“. Diese Gedanken gelten als starker Indikator für zukünftiges suizidales Verhalten. Außerdem zeigen 3 Prozent der Befragten Zeichen von Alkoholabhängigkeit.
Ärztinnen und Ärzte sind damit deutlich häufiger von Depressionen betroffen als die Allgemeinbevölkerung. So zeigen beispielsweise in Deutschland 26 Prozent der Befragten entsprechende Symptome – verglichen mit 6 Prozent quer durch alle Bevölkerungsschichten. In Lettland und Polen sieht es noch düsterer aus: Hier sind laut Studie 50 Prozent der Ärztinnen und Ärzte an Depressionen erkrankt. Laut Studie sind auch die Suizidgedanken bei Ärztinnen, Ärzten und Pflegekräften etwa doppelt so häufig wie in der Allgemeinbevölkerung.
Ursachen: Arbeitsbedingungen und Gewalterfahrungen im Job
Eine wichtige Ursache der Belastung sind die Arbeitsbedingungen von Ärztinnen und Ärzten. Dazu zählen beispielsweise die Arbeitszeiten: Ein Viertel der Befragten (25 Prozent) arbeitet pro Woche mehr als 50 Stunden, etwa 20 Prozent arbeiten regelmäßig in Schicht- und Nachtdiensten. Und auch unsichere Arbeitsverhältnisse sind für viele eine Belastung: So hat fast ein Drittel der befragten europäischen Ärztinnen und Ärzte (32 Prozent) nur einen befristeten Arbeitsvertrag. All das kann negative Auswirkungen auf die psychische Gesundheit haben.
Dazu kommen belastende Erfahrungen mit Gewalt: So erlebt etwa ein Drittel der Befragten Mobbing oder Drohungen am Arbeitsplatz. 10 Prozent berichten von sexueller Belästigung oder körperlicher Gewalt. Für Deutschland gilt: 21 Prozent der Befragten haben schon Mobbing erlebt, 67 Prozent mussten sich mit verärgerten Patientinnen und Patienten sowie Angehörigen auseinandersetzen, 12 Prozent berichten von körperlicher Gewalt und 16 Prozent von sexueller Belästigung. 28 Prozent wurden schon bei der Arbeit bedroht. Besonders Mobbing und sexuelle Belästigung erhöhen dabei das Risiko, an einer Depression zu erkranken. Das ist in beiden Fällen bei rund der Hälfte der Betroffenen der Fall.
WHO mahnt Veränderungen an
„Die Ergebnisse der MeND-Erhebung erinnern uns eindringlich daran, dass die Gesundheitssysteme in der Europäischen Region nur so stark sind wie die Menschen, die sie am Laufen halten“, mahnt Dr. Hans Henri P. Kluge, WHO-Regionaldirektor für Europa. „Ein Drittel aller Ärzte und Pflegekräfte berichtet über Depressionen oder Angstzustände, und mehr als ein Zehntel von ihnen hat schon einmal daran gedacht, sich das Leben zu nehmen oder sich selbst zu verletzen. Dies ist eine unzumutbare Belastung für diejenigen, die für uns sorgen. Aber es muss nicht so sein.“
Die Studienautoren empfehlen daher sieben konkrete Maßnahmen, um die psychische Gesundheit der Mitarbeitenden im Gesundheitssystem zu verbessern:
1) Null-Toleranz gegenüber Gewalt und Belästigung:
- Einführung und Durchsetzung von Strategien zur Verhinderung von Mobbing, Gewalt und sexueller Belästigung am Arbeitsplatz.
- Verbesserung von Meldesystemen und Sensibilisierung für Unterstützungsstrukturen.
2) Verbesserung der Schichtplanung:
- Reduzierung der Unvorhersehbarkeit und Unflexibilität von Schichtplänen.
- Begrenzung von aufeinanderfolgenden Nachtschichten und langen Schichten.
- Förderung von ausreichenden Ruhezeiten und sozialer Unterstützung.
3) Management von Überstunden:
- Sicherstellung, dass Überstunden den Bedürfnissen und Rechten der Beschäftigten entsprechen.
- Förderung einer Kultur, in der Überstunden nicht erwartet oder erzwungen werden.
- Einführung von Mechanismen zur Überwachung und Kompensation von Überstunden.
4) Reduzierung übermäßiger Arbeitsbelastung:
- Verbesserung der Personalplanung und Optimierung von Arbeitsabläufen.
- Einsatz digitaler Technologien und Anpassung der Aufgabenverteilung, um die Arbeitsbelastung zu verringern.
5) Stärkung der Führungskompetenzen:
- Schulung von Führungskräften und Managern, um die psychische Gesundheit der Mitarbeitenden zu fördern und zu schützen.
- Einführung von Leistungskennzahlen, die den Schutz der psychischen Gesundheit der Beschäftigten messen.
6) Zugang zu psychischer Unterstützung:
- Bereitstellung von vertraulichen und stigmafreien Unterstützungsangeboten für psychische Gesundheit und Substanzgebrauch.
- Förderung früher Interventionen und Unterstützung bei der Rückkehr an den Arbeitsplatz nach psychischen Erkrankungen.
7) Regelmäßige Überwachung und Berichterstattung:
- Einführung von Systemen zur regelmäßigen Bewertung der psychischen Gesundheit und der Arbeitsbedingungen auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene.
- Förderung des Dialogs zwischen Stakeholdern und Überwachung des Fortschritts.
Bessere Arbeitsbedingungen könnten die psychische Gesundheit der Ärztinnen, Ärzte und Pflegekräfte dauerhaft verbessern. So könnten die Maßnahmen nicht nur den Krankenstand verringern, sondern auch dazu beitragen, dass nicht immer mehr Mitarbeitende im Gesundheitssystem ihren Job aufgeben wollen. Im besten Fall können so auch neue Menschen für entsprechende Berufe gewonnen werden. So können die Maßnahmen dabei helfen, die europäischen Gesundheitssysteme zukunftsfähig zu machen und angesichts des demographischen Wandels besser aufzustellen. Sollte sich nichts ändern, befürchten die Studienautoren, dass bis 2030 insgesamt 940.000 Ärztinnen, Ärzte und Pflegekräfte in der EU fehlen könnten.