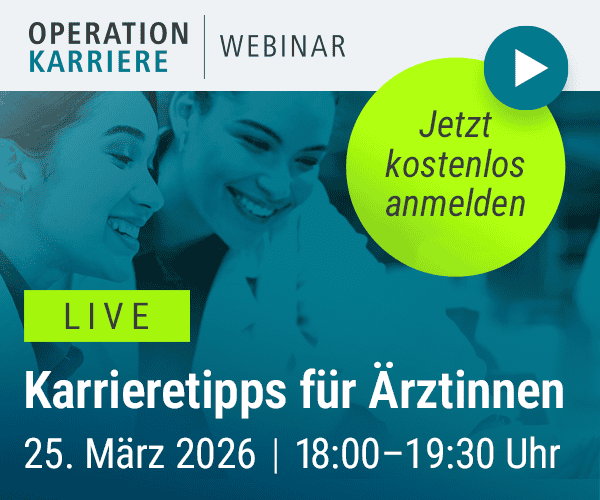In der Arzt-Patienten-Beziehung ergeben sich deutliche Veränderung – in einer Geschwindigkeit, bei der man kaum noch mitkommt. Zwar gebe es das Vorurteil, dass Psychotherapeutinnen und -therapeuten im Vergleich zu anderen ärztlichen Fachbereichen noch ewig in Präsenz ihre Sitzungen abhalten, doch das stimme nicht, sagte Dr. Kastner gleich zu Beginn seines Vortrags.
Große Veränderungen durch Corona
„Das Feld der Telemedizin ist riesig“, beschrieb der Neurologe und Psychiater den derzeitigen Stand. Es gebe keinen Bereich mehr, in dem telemedizinische Technik keine Rolle spiele. Angefangen habe es mit sogenannten Telekonsilen, in denen sich zwei Ärztinnen oder Ärzte, auch aus unterschiedlichen Fachgruppen, virtuell beraten können. Im Bereich der Videokonsile haben sich eigene Klinikstrukturen wie das Virtuelle Krankenhaus NRW entwickelt. Neu komme virtuelle Realität hinzu, beispielsweise können Kinder mit einem Langzeitaufenthalt in der Klinik virtuell in der Schule zugeschaltet werden. Auch im Bereich der Digitalen Gesundheitsanwendungen (DiGAs) sei ein Großteil aus der Psychotherapie.
Videotherapie gebe es schon seit den 60er-Jahren, damals in Form von Kassetten, die aufgenommen und verschickt wurden. „Aber Corona hat letztendlich die Veränderung gebracht“, erklärte Kastner. Dinge, die vorher undenkbar waren, mussten nun machbar werden, sonst hätte es zu Klinikschließungen geführt. Heute finde der Erstkontakt zu einem Psychotherapeuten oder einer -therapeutin oftmals über eine Videotherapie statt.
Die Vor- und Nachteile einer Videosprechstunde in der Psychotherapie
Gleichzeitig werde die Arzt-Patienten-Beziehung bei einer Videotherapie häufig negativ bewertet. Zu den genannten Herausforderungen gehören:
- fehlende persönliche Begegnung
- anderes emotionales Wahrnehmen
- beschränkte non-verbale Interaktion
- fehlende Gestaltung des Kontakts (Getränk, Ruhe, Musik)
- Umgang mit Schweigen? Notfallmanagement?
- Störfaktoren (Haustiere, Klingel, Kinder)
- Reduzierter Blickkontakt durch Technik
- Fehlende körperliche Untersuchung
Die Vorteile einer Videotherapie überwiegen laut Kastner jedoch. Positiv hervorzuheben sei:
- Ergebnisse einer videogestützten Therapie sind vergleichbar mit einer in Präsenz oder sogar besser (besonders bei kognitiver Verhaltenstherapie).
- Negative Übertragungen im direkten Kontakt reduzieren sich, was zu einem schnelleren Therapiefortschritt führt.
- Sichtbare Körpersprache reicht meistens aus
- Überregionale Verfügbarkeit ist ein Vorteil, besonders im ländlichen Raum
- Neue Gruppen bekommen Zugang zur Therapie (PTBS, dissoziative Störungen, Mutter-Kind, pflegende Angehörige, fehlende Mobilität, Gehörlosenpsychiatrie/-psychotherapie)
„Ein paar berechtigte, kritische Momente gibt es“, gestand Kastner. Denn Psychotherapie sei nicht nur Sprechen, sondern dabei kämen auch andere Techniken wie Kreativtherapien, Kunsttherapie, Rollenspiele, Hypnose, Biofeedback oder Flipchart-Arbeit zum Einsatz. Die Effektstärke dieser Techniken und Therapien sei jedoch nicht eindeutig. Zwar sei vieles etabliert, doch dazu fehle die Forschung. „Die effektivste Psychotherapie, die wir derzeit kennen, ist die Gruppenpsychotherapie“, sagte der Mediziner. Hier komme man digital tatsächlich an Grenzen.
Risiken einer Videosprechstunde
Zu den Risiken einer Videotherapie gehöre beispielsweise der Suchtmittelkonsum während der Sitzung. Das bekomme man als Therapeut oder Therapeutin oft nicht mit. Gleichzeitig erhalten sie aber auch Zugang zum intimen Lebensumfeld der Patientinnen und Patienten. „Das ist wie ein unaufgeforderter Hausbesuch, den Sie da machen“, erklärte Kastner. Man solle die Patientinnen und Patienten dazu animieren, immer im gleichen Raum und in der gleichen Position zu sitzen.
Problematisch könne auch das Aufzeichnen der Sitzung durch den Patienten oder die Patientin selbst sein. Das sei zwar nicht erlaubt, aber technisch heutzutage einfach machbar, ohne dass das Gegenüber es merke. Außerdem bestehe das Risiko einer Datenschutzverletzung, wenn sich fremde Zuhörer im Raum befinden, die aber nicht im Bild zu sehen sind. „Es braucht Vorbereitung, es braucht Vertrauen“, zählte Kastner auf. Mit einer guten Vertrauensbasis funktioniere die Videotherapie.
KI als Psychotherapeut
Spannend werden laut Kastner die Chancen in der Zukunft. „Es werden mehr Patienten erreicht werden und vor allem überregional“, sagte er. Eine Videotherapie sei eine gute Alternative zur klassischen und eine gute Ergänzung bei einer bereits laufenden Psychotherapie. Kastner schätzt, dass die Videosprechstunde ein großer Wachstumsmarkt ist, da sowohl ärztliche Kolleginnen und Kollegen als auch viele Patientinnen und Patienten dies wünschen. Ein wichtiges Thema sei darüber hinaus die KI. Möglich sei es schon, dass eine KI die Sitzung aufnehme, automatisch dokumentiere, zusammenfasse und Hinweise für die nächste Sitzung gebe. Ob die KI irgendwann den Psychotherapeuten oder die -therapeutin ersetzen könne? „Ja, da bin ich mir sogar sicher, dass sie das tut“, lautete Kastners Prognose. „Die sind immer so positiv, da können wir noch etwas lernen.“
Quelle: Vortrag „Videosprechstunde – aber doch nicht in der Psychotherapie?! Virtuelle Arzt-Patienten-Kontakte“, Dr. Ulrich Kastner, Chefarzt, Bezirkskliniken Mittelfranken, Operation Karriere München 2024