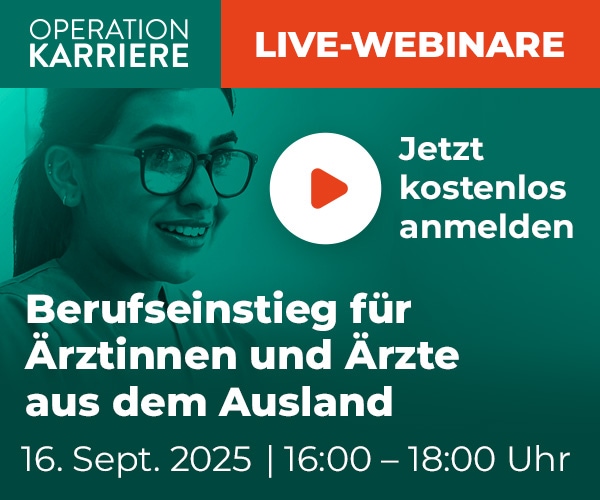Eine wissenschaftliche Grundausbildung ist für alle klinisch tätigen Ärztinnen und Ärzte essenziell, um aus der Informationsflut in der medizinischen Fachliteratur neue Entwicklungen in Diagnostik und Therapie identifizieren und einordnen zu können. «Methodisch-wissenschaftliche Grundkenntnisse stellen eine Bedingung für die Anwendung Evidenzbasierter Medizin dar», sagt Professor Dr. Rolf-Detlef Treede, Präsident der AWMF.
Wissenschaftliche Kompetenz bereits im Medizinstudium fördern
Aber Befragungen von Studierenden zeigen, dass sie die wissenschaftliche Kompetenz im Studium noch nicht ausreichend gefördert sehen. Ebenso wird berichtet, dass Ärzte in der Versorgung oft Probleme haben, Forschungsbefunde richtig zu lesen. Christian Baxmann, Bundeskoordinator für Medizinische Ausbildung; Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland (bvmd) fordert: «Im Hinblick auf die Sicherheit der Patienten wünsche ich mir, dass evidenzbasierte Medizin auch umgesetzt wird, und wir nicht nur theoretisch darüber reden.» Der fachliche Austausch über das Handeln in Kleingruppen sei dafür essentiell, auch Journal Clubs würden sinnvoll zum Verständnis beitragen. Um den Weg des evidenzbasierten Wissens an das Patientenbett zu ebnen, überführt die AWMF ihre Leitlinien in ein digitales Format. Derzeit stehe man in Vertragsverhandlung. «Eine finale Version wird wohl in 3 Jahren einsatzfähig sein», stellt Prof. Treede in Aussicht.
Wie die Stärkung der Wissenschaftskompetenz im Medizinstudium gelingen kann, zeigt die Medizinische Fakultät Mannheim (UMM) der Universität Heidelberg bereits heute: In einem Modellstudiengang werden dort wissenschaftliche Kompetenzen der Medizinstudierenden gefördert. Wissenschaftliche Bezüge werden standardmäßig in der Lehre eingebunden. Evaluationen des Leistungsnachweises «Wissenschaftliches Arbeiten» zeigen, dass dieser Weg auch wirksam ist, um dem Nachwuchsmangel in der Forschung zu begegnen: Fast zwei Drittel der Studierenden sind motiviert, ihre wissenschaftliche Arbeit im Rahmen einer Doktorarbeit zu vertiefen.
Derzeit wird die Wissenschaftskompetenz auch in den Weiterbildungsordnungen nicht adäquat abgebildet. «Als Wissens- aber nicht Handlungskompetenz werden allgemein nur ethische, wissenschaftliche und rechtliche Grundlagen ärztlichen Handelns genannt», betont Professor Dr. Erika Baum, Vorsitzende der Ständigen Kommission Qualitätsentwicklung in Forschung und Lehre der AWMF. Aus Sicht der Expertin reicht dies nicht aus. «Ärztinnen und Ärzte müssen fähig sein, Daten aus dem Versorgungsalltag wissenschaftlich aufbereiten zu können, damit sie für die Forschung nutzbar werden – nicht nur an Universitätsklinika sondern flächendeckend», so Baum. Das sei wichtig, da Registerstudien oder Forschungspraxisnetze helfen, Innovationen zu generieren und die Qualität von Behandlungen zu prüfen, die dann wiederum die Patientenversorgung verbessern. Dafür müssen jedoch Forschungszeiten für die ärztliche Weiterbildung, beispielsweise Clinician Scientist-Programme (CSP) durch alle Landesärztekammern gleichermaßen einheitlich anerkannt werden. In der Praxis sieht das anders aus. Es gibt kein einheitliches Vorgehen, ob und wie wissenschaftliche Tätigkeit anerkannt wird. Einige Ärztekammern sind großzügig, wenn der Gesamtrahmen eine sinnvolle Strukturierung der Weiterbildung zeigt, andere schließen Zeiten wissenschaftlicher Tätigkeit ohne direkten Patientenkontakt kategorisch aus. «Kurzfristig fordern wir, dass generell 6 Monate im Bereich klinischer Forschung oder Versorgungsforschung auf die Weiterbildungszeit angerechnet werden. Zusätzlich sind Zeiten anzusetzen, die spezifische Kompetenzen der jeweiligen Weiterbildungsordnung im Rahmen des CSP berücksichtigen, beispielsweise Forschung zu allergischen Erkrankungen, welche die Kompetenzen der Allergologie stärken und fördern», so Baum. Je nach Programm können dies bis zu 24 Monate mit überwiegend forschungsorientierter Tätigkeit sein. Nur wenn die Verbindung von Forschung, Lehre und Versorgung gelinge, können die Patientinnen und Patienten bestmöglich und wissenschaftlich fundiert behandelt werden, sind sich die Experten einig.
Pressekonferenz des Berliner Forums der AWMF, 16.11.2023
Erstveröffentlichung des Beitrags von Christine Schiller im Februar 2024 in Kompass Autoimmun 1/24, CampusAutoimmun